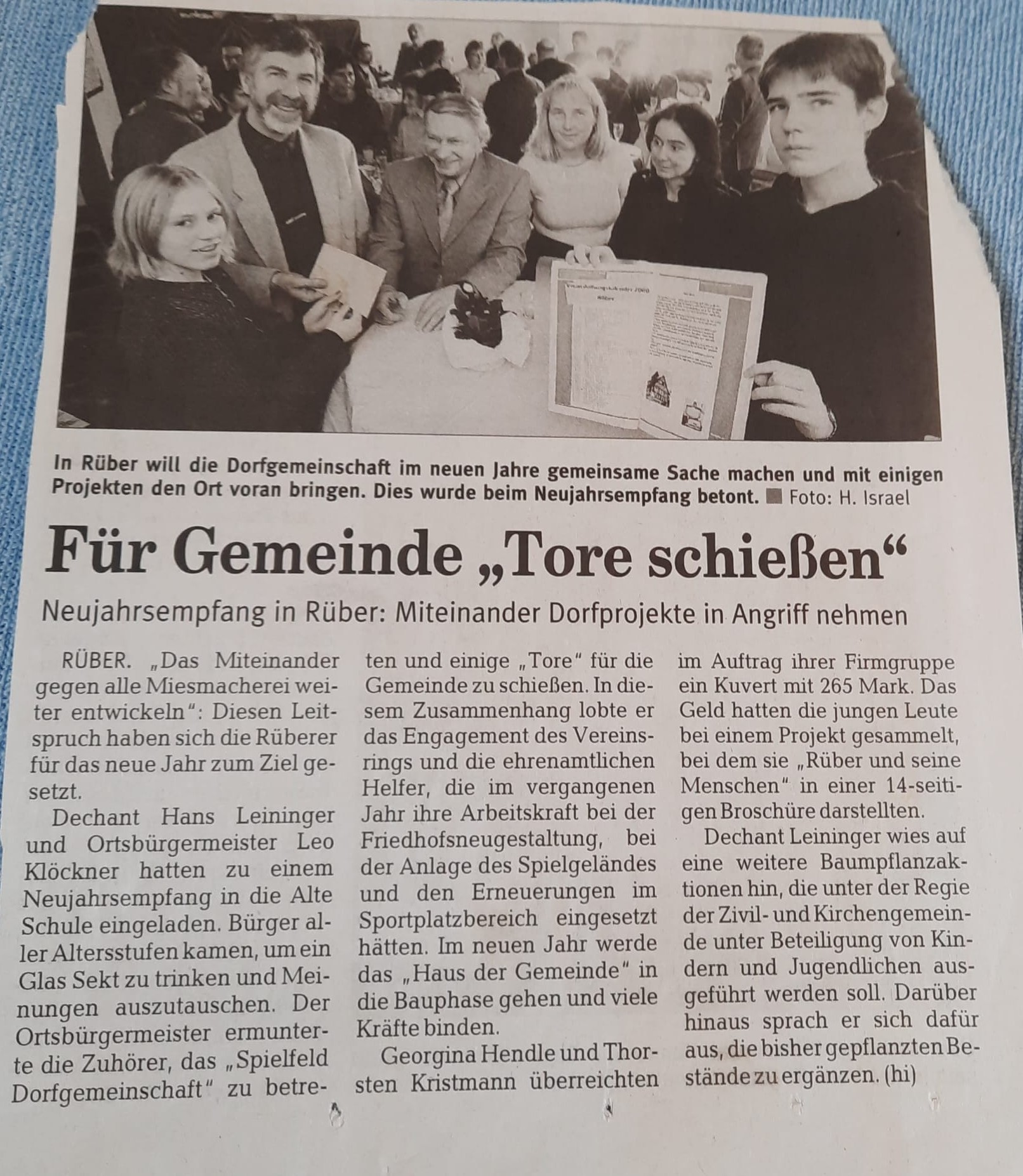Lang ist es her. Passiert in Rüber!
Heribert Scherhag
Ansprechpartner Website
+49 2654 1433


In 2026 ist geplant die Lonniger Straße nach 70 Jahren zu sanieren.
>Passiert in Rüber < Originalberichte aus der Schulchronik.
1949 -Straßenzustand - Straßeninstandsetzung DorfstraßeDie Dorfstraße befand sich in den vergangenen Jahren in einem erbarmungswürdigen Zustand. Zur Winterzeit glich sie an frostfreien Tagen stellenweise einem Morast. Eine Instandsetzung war dringend von Nöten. Nachdem man im vergangenen Herbst eine gänzlich zerfahrene Strecke an der Heidger Mühle in Ordnung gebracht wurde, hat man in diesem Frühjahr die Strecke zur Heidger Höhe mit Teersplitt eingewalzt, anschließend eine Strecke vom Friedhof zur Kaaner Höhe in der gleichen Weise hergestellt und zum Schluss die Dorfstraße mit einer Kleinschlagdecke versehen. Gar zu gern hätte man im Dorfe auch eine schöne saubere Teerdecke gesehen, aber wegen der Kostenfrage wurde die Einwohnerschaft auf später vertröstet.
1953 Straßeninstandsetzung Kirchstraße. Die verlängerte Kirchstraße bot im Verhältnis zu dem, an die Hauptstraße des Dorfes anstoßendem, vorderen Teil der Kirchstraße bislang einen trostlosen Anblick dar. Dieser Teil der Kirchstraße war im Jahr 1938 in vorbildlicher Weise gepflastert worden. Kein Wunder darum, wenn die Anwohner der verlängerten Kirchstraße den Wunsch nach ähnlichen Straßenverhältnissen hegten. Der Weiterbau scheiterte damals, weil die Feldanlieger sich nicht bereit erklärten, den erforderlichen Geländestreifen, der am gleichmäßigen Ausbau der Straße fehlte, an die Gemeinde abzutreten. Erst bei der Umlegung vor einigen Jahren wurde der Gemeinde dieser Streifen zugeteilt. Im Juli dieses Jahres wurde das Grundbett des neuen Straßenteiles ausgehoben. Nachdem seitlich die Rinnen gepflastert waren, wurde die Packlage gesetzt und mit Kleinschlag eingewalzt. Mit mehreren Lagen Teersplitt wurde eine staubfreie Decke geschaffen, sodass die Anwohner jetzt an dem schönsten Straßenteil des Ortes wohnen. Mit 16.800 Mark hat die Gemeinde so ein prächtiges Straßenbild geschaffen.
Die Hauptstraße des Ortes, die unter Obhut des Kreises steht wurde im September eingeteert und mit Splitt überworfen. Es war aber auch höchste Zeit, denn an verschiedenen Stellen fing die Kleinschlagdecke schon an, sich aufzulockern. Umherliegende Steine und Schlaglöcher boten den Passierenden manche Unannehmlichkeiten.
1955 Straßeninstandsetzung Lonniger Straße. Einem langgehegten Verkehrsbedürfnis ist man endlich zu Leibe gerückt. Eine der schlechtesten Teilstrecken war die Straße Rüber - Lonnig. Im September hat man jetzt, nachdem man mit den Feldanliegern wegen der Feldabtretungen zur Straßenverbreiterung endlich ins reine gekommen war, den Ausbau dieser Strecke, vorerst bis zur Gemarkungsgrenze von Rüber in Angriff genommen. Die Ausführung der Straßenbauarbeiten ist der Firma Toni Hillesheim von Mayen übertragen worden. Obwohl die Arbeit auf der ganzen Wegesstrecke aufgenommen wurde, war man doch bestrebt, das Dorfstück sobald als möglich fertig zu stellen, damit die Bauersleute ihre Erntevorräte vor Winter doch noch teilweise in ihre Keller einbringen konnten. Mit einem Bagger wurde die Erde etwa 80 cm tief ausgehoben, so dass an manchen Stellen schon die Wasserleitungsrohre sichtbar wurden. Jetzt wäre der geeignete Zeitpunkt für die Gemeindeverwaltung Rüber gekommen gewesen, ihr Wasserleitungsnetz zu überprüfen und auszubessern, liegen doch die Rohre schon 50 Jahre in der Erde. Anscheinend war man der Meinung, dass sich in den nächsten 20 Jahren keine Rohrbrüche einstellen würden. Zum Schutz gegen Frost wurde eine Lavalitschicht von 20 cm als Unterbau verwendet. Die darauf ruhende Packlage und Straßendecke wurden mit Teersplitt gleichmäßig abgedeckt und angewalzt. Vor Winter wurde diese kurze Dorfstück restlos fertig gestellt.
Originaltext aus der Schulchronik Rüber. H. Sch